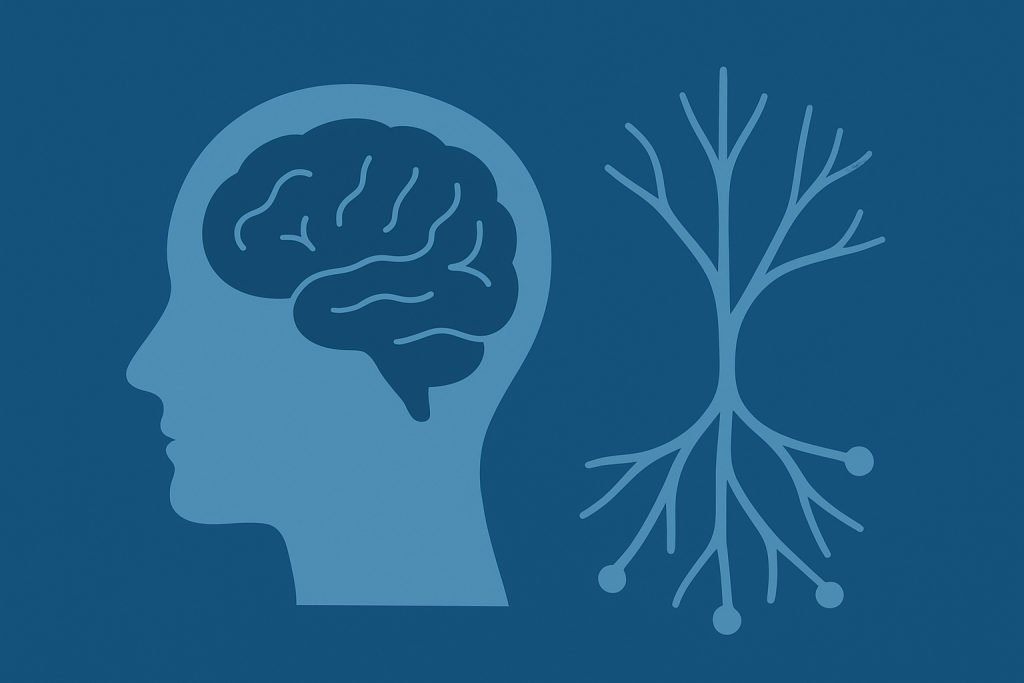Das Problem bei vielen gescheiterten Veränderungsversuchen ist nicht mangelnde Willenskraft, sondern ein überfordertes Nervensystem. Solange sich die Veränderung unsicher anfühlt, wird der Körper Widerstand leisten. Was also ist zu tun?
Mit dem Rauchen/Naschen/Netflixen usw. aufhören, weniger Alkohol trinken, weniger am Smartphone hängen, mehr Sport treiben, gesund essen, jeden Tag meditieren … So mancher guter Vorsatz ist Geschichte, noch bevor man richtig mit der Umsetzung angefangen hat. Und du fragst dich: «Warum gelingt es mir nicht, meine Gewohnheiten zu verändern, obwohl ich es will?»
Gewohnheiten verändern: Das passiert im autonomen Nervensystem
Um zu verstehen, warum es so schwer ist, Gewohnheiten zu verändern, müssen wir einen Blick auf unser autonomes Nervensystem werfen. Das autonome Nervensystem besteht aus zwei Hauptzweigen:
- Sympathisches Nervensystem („Kampf-oder-Flucht-Modus“)
- Parasympathisches Nervensystem („Ruhe- und Erholungsmodus“)
Dieses System reguliert unsere grundlegenden Überlebensfunktionen, wie Atmung, Herzschlag und Verdauung – aber es beeinflusst auch, wie wir auf Veränderungen reagieren. Das Nervensystem bewertet jede neue Situation nach einem einfachen Prinzip: Ist es sicher oder gefährlich?
Neue Gewohnheiten bedeuten Veränderung, und Veränderung wird vom Nervensystem oft als potenzielle Bedrohung eingestuft. Auch wenn eine neue Gewohnheit objektiv gesehen gut für dich ist, empfindet dein Nervensystem sie möglicherweise als unsicher, weil sie ungewohnt ist. Und genau hier liegt die Herausforderung: Wir bevorzugen das Vertraute, weil es vorhersehbar und daher sicher erscheint.
Gewohnheiten verändern: Wenn man will, aber nicht kann
Gewohnheiten sind fest in unserem Gehirn verankert. Wenn wir eine Handlung oft genug wiederholen, entsteht eine Art «Autopilot». Unser Gehirn speichert diese Abläufe in den Basalganglien, einer Region, die für wiederholte Verhaltensweisen zuständig ist. Dadurch müssen wir nicht jedes Mal aktiv über bestimmte Handlungen nachdenken, was kognitive Energie spart.
Das Problem ist jedoch, dass auch hinderliche Gewohnheiten auf diese Weise tief verwurzelt sind. Wenn du beispielsweise seit Jahren nach dem Mittagessen automatisch nach etwas Süßem greifst, geschieht das ohne bewusste Entscheidung. Selbst wenn du dir vornimmst, es nicht zu tun, greift dein Nervensystem auf das bewährte Muster zurück – einfach weil es «leicht» und «sicher» erscheint.
Hinzu kommt, dass unser Gehirn auf Belohnung programmiert ist. Jede angenehme Erfahrung setzt Neurotransmitter wie Dopamin frei, die uns ein gutes Gefühl geben. Ungesunde Gewohnheiten (z. B. Rauchen, Zucker, Social Media) sind oft mit einer schnellen Belohnung verbunden, was ihre Aufrechterhaltung noch verstärkt.
Die Komfortzone – unser Sicherheitsnetz
Unsere Komfortzone ist der Bereich, in dem wir uns sicher fühlen. Hier kennt unser Nervensystem alle Abläufe, und nichts scheint unkontrollierbar. Doch um eine Gewohnheit zu ändern, müssen wir diesen Bereich verlassen. Das Problem dabei: Unser Nervensystem ist auf Sicherheit bedacht. Jede Abweichung vom Gewohnten aktiviert potenziell den Stressmodus, selbst wenn die geplante Veränderung positiv ist.
Das erklärt, warum es so schwer ist, Gewohnheiten zu verändern und eine neue Routine aufzubauen. Wenn du beispielsweise beschließt, früh aufzustehen und zu meditieren, fühlt sich das am Anfang unangenehm oder sogar stressig an. Dein Körper sendet Signale wie Unruhe oder Widerstand – nicht, weil die neue Gewohnheit schlecht ist, sondern weil sie ungewohnt ist.
Hier kommt das neurosomatische Coaching ins Spiel.
Wie Brain Coaching und neurosomatisches Coaching helfen können, Gewohnheiten zu verändern
Brain Coaching und neurosomatisches Coaching basieren auf Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft und der Körperarbeit. Sie helfen dir, dein Nervensystem zu regulieren, damit Veränderungen sich sicher anfühlen.
1. Bewusstes Arbeiten mit dem Nervensystem
Anstatt gegen dein Nervensystem zu arbeiten, kannst du es gezielt unterstützen. Das neurosomatische Coaching nutzt Techniken, die dem Nervensystem signalisieren: Veränderung ist sicher. Dazu gehören beispielsweise:
- Atemtechniken, die das parasympathische Nervensystem aktivieren und für Entspannung sorgen.
- Körperübungen, um Spannungen zu lösen und eine Verbindung zwischen Geist und Körper herzustellen.
- Visualisierungen, um dem Gehirn die neue Gewohnheit als «bekannt» und «sicher» zu präsentieren.
2. Neue Gewohnheiten schrittweise etablieren
Ein häufiger Fehler bei der Veränderung von Gewohnheiten ist, dass wir zu viel auf einmal wollen. Doch der Weg des Nervensystems ist Kaizen: Es bevorzugt kleine, schrittweise Veränderungen. Mikrogewohnheiten helfen dir, Veränderungen nachhaltig zu verankern.
Anstatt von heute auf morgen eine komplette Morgenroutine einzuführen, könntest du zum Beispiel mit zwei Minuten Dehnen oder einer 30-Sekunden-Atemübung beginnen. Das Nervensystem gewöhnt sich so langsam an die Veränderung und empfindet sie nicht als Bedrohung.
3. Emotionale Blockaden auflösen
Hinter bestimmten Gewohnheiten stehen oft emotionale Muster oder tief verwurzelte Glaubenssätze. Vielleicht hast du in der Kindheit gelernt, dass Essen Trost spendet – was es später schwer macht, ungesunde Essgewohnheiten loszulassen. Und beim Rauchen geht es in Wirklichkeit um Zugehörigkeit. (Darüber schreibe ich ein anderes Mal.)
Neurosomatisches Coaching arbeitet mit dem Körpergedächtnis und kann helfen, alte Muster aufzulösen. Durch gezielte Körperarbeit und emotionale Reflexion kann das Nervensystem «ernen, dass es auch ohne die alte Gewohnheit sicher ist. Eine super Methode hierzu sind die Emotional Freedom Techniques (EFT).
4. Neue Verbindungen im Gehirn schaffen
Das Gehirn kann sich ein Leben lang verändern. Das nennt man Neuroplastizität. Jede neue Erfahrung formt neuronale Verbindungen. Je öfter wir eine neue Gewohnheit ausführen, desto stärker wird die neuronale Verbindung, bis sie schließlich automatisch abläuft. So entstehen im Gehirn neue Reaktionspfade. Und irgendwann ist die alte, vielleicht schädliche Gewohnheit mit einer neuen, besseren Gewohnheit überschrieben.
Fazit: Gewohnheiten verändern ist möglich – wenn das Nervensystem mitspielt
Braincoaching und neurosomatisches Coaching helfen dir, das Nervensystem sanft in den Veränderungsprozess einzubeziehen, sodass neue Gewohnheiten nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen werden. Dadurch wird es leichter für dich, nachhaltige Veränderungen zu etablieren – auch ohne Aufbietung deiner gesamten Willenskraft.
Wenn du also das nächste Mal daran scheiterst, eine Gewohnheit zu ändern, frage dich: Wie kann ich meinem Nervensystem dabei helfen, sich sicher zu fühlen?
Welche neuen, positiven Gewohnheiten möchtest du in deinem Leben etablieren? Was möchtest du dir endlich abgewöhnen? Ich unterstütze dich dabei und beantworte gerne deine Fragen.
Mehr dazu
Gefühle regulieren mit EFT
The Science of Making & Breaking Habits (Huberman Lab)
Dieser Text wurde mit Hilfe von ChatGPT erstellt und von mir kontrolliert und redigiert.